|
Den Zeltplatz Hrossaborg um 9 Uhr verlassend ritten
wir den ganzen Tag in fast direkt südlicher Richtung.
Die flache Plattenlava der östlichen Ódáđhraun ließ auf
Meilen im Umkreis beständigen Überblick zu, und
während elf Stunden hatten wir unser Tagesziel, den
Herdubreiđ, vor uns.
Würden wir auf dem Grasplatz, an seinem Fuße, —
der Oase Lindir, wie sie kurzweg genannt wird —
genügend Gras finden? Zwei Tage sollten unsere
22 Pferde dort ausruhen, ehe. der schwere Ritt in die
Askja unternommen wurde. Außerdem aber mußten
noch mehrere Säcke Gras geschnitten werden können,
das mitgenommen zur Fütterung dienen sollte, gleich
nach unserer Ankunft in der Askja.
Vor mehr als zwanzig Jahren war Professor
Thoroddsen in Lindir gewesen, später noch einmal ein
Amerikaner, um die Ersteigung des Herdubreiđ zu
versuchen. Wie konnte sich alles verändert haben, wenn wir
der Enttäuschung bei den Varmäquellen in Laki
gedachten! Fanden wir aber am Fuße des Herdubreiđ kein
Gras, so mußten wir auf dem „Wege", den wir bis jetzt
gemacht, die 80 km zurück bis Skútustađir, um neuerlich
von dort über Svartárkot zur Askja zu reiten. Die
Route über Lindir hatten wir gewählt, um ein mög-
lichst großes Gebiet durchstreifen zu können, glaubte
ich doch noch immer, ehe ich den Knebel-See und
die Askja gesehen, daß ein Entkommen der
Verunglückten möglich und uns vielleicht hier eine Spur
von ihnen werden könne.
Den ganzen Tag bei unserem Ritt über die
blaugrauen Lavaplatten der Grafarlönd, die hie und da
überstreut sind von schwarzbraunen vulkanischen
Aschensanden, ohne einen Halm, ohne einen Tropfen
Wasser für die Pferde und uns, gab uns allen der
Gedanke an das Gras mehr als erwünscht Beschäftigung.
Die Gegend erinnerte lebhaft an den Sprengisandur.
Hier wie dort der unendliche Horizont, der jenseits
unpassierbarer Gletseherströme mehr als ein
unerreichbares Ziel aufwies, hier wie dort die monotonen Farben,
die ohne Wechsel flächenhaften Formen, hier wie dort
weder Gras noch Wasser.
Um 7 Uhr abends schimmert es verheißungsvoll
grün vor uns auf, das kann nur die Oase Lindir sein!
Die Pferde in Trab gesetzt und Alles vorwärts, die
Müdigkeit ist vergessen bei ihnen und bei uns.
Nach einer Viertelstunde erreichen wir ein
Flüßchen — inmitten von Zwergpappeln, Binsen, wenig
Birkengestrüpp, Moos steht allerhand bitteres Blätter-
werk, an dem die Pferde naserümpfend vorübergehen.
Triebsande sind hier, freilich Wasser, aber noch kein
Gras. Spärlich verteilte ausgeblichene Halme zeigten, daß
hier der Sandsturm sein Werk zum Teil schon vollendet.
Sigurđur und Helgi untersuchen das grüne Land
weiter nach Westen, nach einer Viertelstunde kommen
sie zurück — „no grass."
Kurze Zeit dürfen wir nur noch weiter gehen
mit den hungrigen Tieren, finden wir dann nichts, so
wird umgekehrt und wir müssen unser Nachtlager auf-
schlagen bei der kargen Sandhafer-Insel, die wir vor
fünf Stunden passierten.
Also noch einmal im Trab weiter vorwärts und
schon nach zehn Minuten haben wir das erste gute
Gras! Jetzt sind wir bewahrt vorm Umkehren-Müssen.
Ein tiefes, gelbes Gletscherwasser wird gekreuzt
und um 8 Uhr abends wird abgesessen. Hart an einem mit
Blumen verbrämten, melodisch rieselnden Bach werden
unsere Zelte gesetzt; einige Schritt nach der anderen
Seite trennt uns der gelbe Gletscherfluß, — wie sich
später herausstellte ein Seitenarm der Jökulsá — von
der Lava, die sich als finsteres Bollwerk türmt zu
Füßen der stolzen, wie die Literatur angibt „von
ewigem Gletscher bedeckten" Felsenburg des
Herdubreiđ.
Eine wunderbar schöne Oase inmitten der sich
nach allen Seiten meilenweit erstreckenden Lavawüste
Ódáđahraun war der Grasplatz Herdubreiđarlindir.
Fast wie auf ihn geschrieben scheint die Einleitung
zu dem Roman „Heiđarbyliđ" des isländischen Dichters
Jön Trausti. Ich gebe in den folgenden Zeilen meine
Übersetzung eines Teils derselben wieder:
(Herrn H. Erkes in Köln ist von dem Autor das alleinige
Recht der Übersetzung ins Deutsche erteilt worden. Herr
Erkes hat die erste Hälfte der Einleitung in seiner soeben
erscheinenden Broschüre: „Aus dem unbewohnten Innern Islands."
Dortmund 1909, in weiterem Umfange veröffentlicht.
Liebenswürdigerweise hat er mir nun gestattet, meinen, seit lange
übersetzten Abschnitt ebenfalls zu bringen, um Trausti's meisterhafter
Schilderung der unbekannten Schönheit seiner Heimatinsel zu
weiterer Verbreitung zu verhelfen.):
„Jene, welche an den Küsten Islands
vorüberfahren, sehen wenig von dem Lande.
Sie schauen die Meeresnebel und vielleicht bis
hin zum wilden Polareis, sie sehen das Schäumen der
Brandung über den unterseeischen Klippen, die
Vögelvölker um die Wasserfalle und das Schiff inmitten.
Sie sehen die riesenhohen Felsenzacken, soweit
das Auge reicht, sich in Reihen nebeneinander
auftürmen; sie ragen bis zum Himmel empor und oft
hüllen Wolkenmäntel ihre Spitzen ein. Auf ihrem
Rücken breiten sich weite Firnflächen. In ihrer Mitten
öffnen sich schmale Fjorde voller Seetücken. Kleine
Handelsplätze liegen an ihrem Ufer. Rauchwölkchen
ringeln sich an den Bergen empor; Segelschiffe suchen
Schutz hinter den Klippenwänden.
Am Ende des Fjordes schließen im bläulichen
Duft verschwimmende Bergecken den Blick ins Innere
ab, weit ziehen sie hinein, von dem flachen Strande.
Und dann liegt dort das Land unter der
Mittsommersonne wie ein blauer Streifen. Die Gletscher schimmern
herab. Die Bergumrisse und das flache Land
verschwimmen ineinander im dämmerblauen Duft.
Herrlich ist dieser Anblick. Manchem wird er
unvergeßlich bleiben.
Aber hinter diesen hochragenden Fjordbergen,
hinter den Höhen, welche das Buchtende schließen,
weit hinein, jenseits der schaumbeflogenen Ufersande,
weit — weit drinnen im Duft der Ferne liegt ein anderer
Teil Islands, so gänzlich verschieden von dem, dessen
Eindruck jene auf ihren Schiffsplanken mit sich
davontragen.
Dort liegt das Heideland, öde und unberührt, und
ist doch so wertvoll wie gute Sommerweiden. Dort
lächeln grüne Sumpfwiesen und grasreiche Fleckchen,
Wasserfälle und fischreiche Seen.
Wellengleich flutet das Schilfgras über weite, nie
bebaute Strecken. Blauveilchen duften im Schatten
der klaren Quellen. Dort blühen sie und dort
vergehen sie ohne eines Menschen Auge zu erfreuen. Die
Sumpf-Njoli steht kerzengerade und trägt ihr Köpfchen
hoch. Sie ist gekrönt mit königlicher Hoheit. Salomo
in aller seiner Herrlichkeit war nicht so gekleidet als
wie eine von ihnen. Und keiner ist da ihre Schön-
heit zu sehen.
Der blütentragende Ebereschenstrauch fächelt sein
Blätterwerk in der sanften Sommerbrise. Dort ist
Gastfreundschaft der Natur, Schutz und Behagen; nicht ein
einziger kommt es heimzusuchen.
Abgründe breiten ihre Arme klaftertief, sie sind
von oben bis hinab mit Grün verbrämt. Es kommt
nicht eine einzige Kreatur, dies alles zu genießen, nicht
einmal ein dummes Schäfchen.
Freie Vogelscharen schweben über die Heide
und ergreifen Besitz von Nistplätzen, wo es ihnen
behagt. Schneeweiße Schwäne lassen ihre schimmernden
Federn dort in einem jeden Sommer. Sie sind so
sanft und zahm wie die Lämmer; sie lernten nicht
den Menschen zu fürchten.
Die andere Welt ist verborgen durch die
umringenden blinkenden Gletscher und bläulichen
Bergzacken, durch die schwärzlichen Lavaströme und die
graubraunen Sandwüsten.
Dieser Teil Islands ist eine Welt für sich mit
Sommerwonne und Wintersgrauen. Er ist sehr schön,
überwältigend großartig und von unendlicher Weite.
Wo ist seinesgleichen! — Es sind nicht mehr
viele, die noch davon zu erzählen wissen.
Jetzt, im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts liegt
die Volksstraße Islands draußen auf der See, in den
Fjorden und um die Vorgebirge.
Früher zogen sie alle durch das Land. Jeder
wußte die weiten Reisewege und sie berieten darüber
ernst und langwierig. Die Heidelande waren jedem
Manne bekannt, ein Jeder wußte die Furten in den
Flüssen zu finden. Damals wagten die Leute
mühevolle und gefahrdrohende Landreisen von Kindheit auf
und erwarben sich Blickesschärfe auf den Gebirgspfaden.
Auch durch die Ódáđahraun führten
Menschenspuren und solche von Pferdehufen. Zu jener Zeit
leitete der Edle sein Gefolge dort, wo es jetzt dem
Führer schwierig wird, eine Wegspur zu finden.
Jetzt verwachsen die alten Saumpfade in der Heide,
sie werden von Erde erfüllt, vom Sandflug verschüttet.
Von manchem weiß kein Mensch mehr, wie sie einst
führten.
Islands schöne, majestätische Hochlande sinken
in Vergessenheit und verlöschen nach und nach in
dem Bewußtsein des Volkes.
Ihre Namen werden vergessen".
Der Name von Lindir ist noch nicht vergessen,
— die Karten Islands führen ihn weiter. Vielleicht
vergehen wieder zwanzig Jahre, ehe die schweigende
Schönheit durch ihren unvergänglichen Zauber andere
Wanderer entzückt.
Früh am nächsten Morgen zog Herr Reck zum
Berge Kolotta Dyngja, mit Sigurđur und Trygve.
Soweit es möglich, ritten sie über die Lava, nach zwei
Stunden kam Trygve mit den leeren Pferden zurück.
Dieser Schildvulkan, elegant und ebenmäßig wie alle
seiner Art, erhebt sich über einer gewaltigen
kreisrunden Basis allseits gleichmäßig sanft ansteigend zu
der geringen Höhe von nur 420 m über seine
Umgebung, unfern vom Fuße des Herdubreiđ aus den
unermeßlichen Lavaweiten der Ódáđahraun.
Kurz nachdem sie den Zeltplatz verlassen und
Helgi nach Süden geritten war, um für uns die
Passierbarkeit der Lava in der Richtung zu den Dyngjufjöll
zu erkunden, erhob sich ein wütender Sturm, der das
Zelt umzureißen drohte. Ich suchte durch aufgestapelte
Kisten und Packsättel die Südseite desselben gegen
den Anprall zu schützen. Nicht lange währte es und
Sandwolken hüllten die Ferne ein. Daß zum
Grasmähen nicht nur Energie, sondern auch Übung gehört,
mußte ich resigniert einsehen, daher blieb mir als
einzige Beschäftigung, vom Zelt aus eine Farbenskizze des
Flusses, der dicht an unseren Zelten vorbeirauschte,
aufzunehmen.
Die Triebsandinseln, die eigenartige Vegetation
der Ufer, bestehend aus kaum kniehohem
Pappelgestrüpp,
durchsetzt von welkendem Gras und Binsen,
das alles trug eine ganz andere Physiognomie als Pu-
fuver und Nyidalur am Sprengisandur. Nachdem ich
eine zweite Skizze von der Kolotta Dyngja vollendet,
kehrten um 8 Uhr abends Herr Reck und Sigurđur
sehr befriedigt von ihrer Besteigung des Berges zurück.
Früher schon war Helgi gekommen, er glaubte eine
gute Passage für uns gefunden zu haben und sprach
außerordentlich viel und lebhaft darüber mit Trygve.
Noch einen Tag sollten die Pferde ruhen, ehe
die mühevollste Arbeit, die sie in unserem Dienst
ausgeführt, für die treuen Tiere begann. So blieb auch
für Herrn Reck noch ein Tag, — freilich kein
Ruhetag — um diese fast nie betretene, unter den Gelehrten
nur einmal vor vielen Jahren von Thoroddsen bereiste
Gegend zu untersuchen. War es ein Wunder, daß das
Geheimnis des 1660 m hohen Herdubrei9 ihn lockte,
seine zähe junge Kraft zu erproben? — Noch nie
waren die riesenhohen Palagonitsäulen seiner Flanken
erklommen, noch nie die Schutthalden, aus denen sie
jäh emporstreben, von eines Menschen Fuß betreten!
— Von je galt der Berg für unbesteigbar, keiner noch
versuchte den Bann zu brechen.
Früh um 8 Uhr gingen Herr Reck und Sigurđur
fort. Mir blieb, gleich den Pferden, ein langer Ruhe-
tag, um Kräfte zu sammeln für den Ritt in die Askja.
Während Trygve und Helgi Gras schnitten, brachte
ich drei Skizzen zur Ausführung und besuchte die
nahe Jökulsá í Axarfirđi, an deren flachem Ufer ich
lange saß, um mir unvergeßlich das Bild ihrer eigen-
artigen Wildheit einzuprägen. Wieder tobte der Sand-
sturm stundenlang, aber gegen Abend wurde die Luft
ganz klar.
Als die Sonne zu sinken begann, erscholl von der
gegenüberliegenden Flußseite, aus der Lava, der Ruf
nach den Pferden, die Reck und Sigurđur durch das
Wasser tragen sollten.
Eine Farbensymphonie von seltener Pracht
entfaltete sich um uns. Über die weite Grasebene
und die jenseitige Lava hin übergoß die Sonne mit
rosigem Schimmer den 60 km südwestlich entfernten
Vatna-Jökull. Gegen Süden lag eine Reihe dem Keilir
in Reykjanes ähnlich geformter Tuffberge, die sich
wie dunkle Pyramiden kupferfarben überschienen aus
der umgebenden flachen Wüste erhoben. Östlich
verschwammen ferne, fremde Berge in lilalichten Tönen.
Während im Westen die Kolotta Dyngja sich unter den
sie streifenden Strahlen in duftige Schleier aufzulösen
schien, kamen die Beiden aus dem tiefdunklen Schatten
der Lava in den im Abendrot feuersprühenden Fluß
geritten — stolz und froh — der Herdubreiđ war
bezwungenl —
Auf der höchsten Spitze hatten sie einen Varđa
errichtet, für uns alle mit dem Glase gut erkennbar.
Abgesehen von dem hohen wissenschaftlichen Wert,
welchen diese Erstbesteigung hatte, brachte sie unserem
Ritt zur Askja großen praktischen Nutzen, da es den
Beiden möglich gewesen, von der großen Höhe meilen-
weit die Gegend zu überblicken. Sie sahen, wo zwischen
dem Herdubreiđ und den Dyngjufjöll, durch stärkste
und gleichmäßigste Bimsteinüberschüttung, die Lava
ihrer Unebenheiten fast beraubt und daher verhältnis-
mäßig leicht zu passieren war.
Wohl waren sie durch die außerordentlich
mühevolle und sehr gefährliche Kletterarbeit ermüdet, aber
die Freude, daß das kühne Unternehmen gelungen,
Ruhe und Essen erfrischten sie, so daß uns anderen
noch manche Einzelheit über diese hochinteressante
Bergbesteigung mitgeteilt wurde. Am fesselndsten waren
die folgenden Ausführungen:
Das flache Plateau, das über den senkrechten
Lavawänden die Höhe des Berges bildete, war fast
erreicht, noch eine Stufe über die schwarze Lava, dann
mußte man über den Rand hinwegblicken können.
Vorsorglich wurden die Schneebrillen aufgesetzt, um
nicht von dem sonnenbeschienenen Gletscher geblendet
zu werden, der ja nach den Karten dieses Plateau
bedeckte. Welches Staunen, als nur schwarze Lava und
ein paar schmutzige Schneeflecke sich dem Auge boten,
statt der erwarteten unberührten Gletscherreinheit!
Doch die Sonne war gesunken, das Gold des
Flusses verblaßt in stumpfe Töne, ein kühler Wind
wehte über die Weiten, und bald empfing erquickende
Ruhe uns Alle. —
|




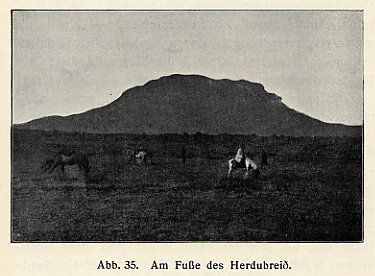
![]() Zurück zu Inhalt
Zurück zu Inhalt![]() nächstes Kapitel
nächstes Kapitel